|
PARIS II Meudon-Chaville 1989>>
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |

|

|
|
|
|
 Image title would go here.
Image title would go here.
|
 Image title would go here.
Image title would go here.
|
Band 140, April – Juni 1998, Seite 256, DOKUMENTATION
KUNST UND LITERATUR: DIE UEBERSETZER UND VERMITTLER
GEORGES-ARTHUR GOLDSCHMIDT:
»Ich stehe da und bin das Auge auf dem Kuechentisch«
EIN GESPRAECH VON HEINZ-NORBERT JOCKS
Georges-Arthur Goldschmidt, 1928 in Reinbek bei Hamburg in grossbuergerlich-protestantischer Familie juedischer Herkunft geboren - sein Vater ueberlebte Theresienstadt, der Sohn floh nach Frankreich -, schrieb Romane und Essays in Franzoesisch. Deutsch ist ihm zur Sprache der verlorenen Kindheit geworden, eine Exilsprache, aus Leiden geboren. UEbersetzen, behauptet der psychoanalytisch beschlagene Goldschmidt, sei stets eine Arbeit des Unbewussten: Ein Bilderstau wartet nur auf den Zugang zur Sprache. Darin unterscheidet sich der UEbersetzer vom Schriftsteller, der Adept vom Autor, nicht mehr. Kein Wunder, dass er sich schliesslich zwei, drei Autoren mit Leib und Seele verschrieben hat, Nietzsche zuerst, dessen Zarathustra er nach einem Schluesselerlebnis einfach uebersetzen musste, dann Kafka, vor allem aber Peter Handke. Ohne diesen UEbersetzer, der sich als ein in Malerei verliebter Augenmensch versteht, gaebe es Handke in Frankreich nicht. UEber seine Liebe zur Bildenden Kunst, seine tiefe Skepsis, die Genese von Bildern, ueber Auge und Geist sowie ueber Sehen und Schreiben, das Malen mit Woertern oder mit Farben sprach in Paris mit ihm Heinz-Norbert Jocks.
*
H.-N.J.: Stimmt es, dass Sie sich durch das UEbersetzen Handkescher Prosa in eine Sprache hineinfanden, von wo aus Ihr spaet beginnendes Erzaehlen erst moeglich wurde?
G.-A.G.: So ist es, aber meine Geschichte ist dann doch meistens literarisch erdacht. Ich weiss gar nicht mehr, was daran erfunden oder autobiographisch ist. Zwei Buecher habe ich frueher geschrieben, naemlich: Ein belangloser Leib und Der Fidibus. Beide waren so ausufernd, aufgeblaeht, kritisch, hektisch und ein bisschen sozialkritisch, wie von Celine beeinflusst, irgendwie boshaft und koloriert. Es stimmt, die UEbersetzung hat dann mein eigenes Schreiben voellig veraendert. Mein Warmschreiben, um es mit meinem Freund Paul Nizon zu sagen, ist die UEbersetzung gewesen. Dadurch, dass ich diesen praezisen Bildgestalter Handke so sprachnah kennengelernt habe, dessen Buecher ich am liebsten selber geschrieben haette, kann ich mein eigenes Schreiben auf mich zukommen lassen. Ich bin nicht von ihm beeinflusst worden, denn es gibt keine Einfluesse, sondern nur Treffen. Aber die Begegnung mit seiner Schreibart in Form des UEbersetzens hat es mir ermoeglicht, zu meiner eigentlichen Schreibweise zu gelangen, die sich am Sehen orientiert. Ein Sehen, das Bilder zeugt, und so verstehe ich mich als ein Maler mit Worten.
In Ihren Buechern umkreisen Sie wiederholt den Garten Ihrer Kindheit.
Ja, einen erotischen.
Als Leser frage ich mich, ob der erwachsene ein anderer als der kindliche Goldschmidt ist.
Ich bin immer noch sechszehn und entdecke die Wollust. In mir trage ich die Erinnerung an einen bestimmten Oktobertag, bevor ich aus dem Heim abgeholt wurde. Von jener Sekunde weiss ich noch, wie sie war. Da bin ich ploetzlich in mich selber hineingekippt und wusste von da an, dass es sich niemals in meinem Leben aendern wird. Ich stecke in mir unveraenderlich, wie ich mich damals in diesem Schlafsaal entdeckt habe. Es war an einem Abend, dass ich da alleine war. Ich weiss nicht mehr, was ich da machte. Nur erinnere ich mich an stuermisches Wetter, und der Berg gegenueber war bereits ein bisschen dunkel, eine ruckartige Erfahrung, wie es Handke ausdruecken wuerde.
Mehr bitte zu Ihrer Biographie!
Meine Biographie ist keine normale, denn ich bin ein Waisenkind. Als Zehnjaehriger verliess ich meine Eltern, ohne sie jemals wiederzusehen, und ich weiss, dass in Internaten aufgewachsene Vollwaisen aehnlich wie ich reagieren. Das Waisenkind, ganz auf sich angewiesen, ueberlebt unter voellig anderen. Seine Beschuetzer sind Fremde, deren Strafe und Blick er fuerchtet. Dadurch bedingt, kommt dieses Gefuehl von eigener Dauer in ihrer Unbeweglichkeit auf. Ich lese das bei Sigmund Freud, der mir auf franzoesisch immer so komisch vorkommt, weshalb ich auch Quand Freud voit la mer veroeffentlichte. Ein Buch, das unuebersetzbar ist, weil es zwischen den Sprachen stets unaufhaltsame, ja unueberwindbare Verschiebungen gibt. Fuer ihn ist das Unbewusste unhistorisch und unbeweglich, dabei ist es das Deutlichste, das es gibt. Das nennt der franzoesische Schriftsteller Christian Pierre Jouan Das Gesetz. Nicht das Gesetz der Unterwelt ist gemeint, sondern das Gesetz von Unten, das ich als unteres Gesetz bezeichnen wuerde. Er sagt wie ich das Gegenteil von Jean-Paul Sartre, fuer den nichts Unbewusstes existiert. Im Wandel ist stets das Gleiche, nicht wahr. So ein Jean-Jacques Rousseau, der sich hinsetzte und sich zuhoerte, wie er existiert, ist so aufregend, wie wenn ich stundenlang im Gebirge sitze und hoere, wie sich in mir nicht das Sein, sondern das Existieren abspielt.
Was meinen Sie damit?
Fuer mich ist die Feststellung, dass ich existiere, das absolute Wunder: ein Himmelssegen, ohne Hunger und Sorgen und noch gesund zu sein, nicht zu frieren, hier und jetzt einfach nur da zu sitzen und in mir zu spueren, wie sich die Dauer ereignet. Kennen Sie Henri Bergsons Buch Denken und schoepferisches Werden? Ich bewundere es, weil sich bei ihm das Mysterioese, Unfassbare, das Nicht-Ansprechbare ueberall durchzieht. Das, was man immer wieder anspricht und einem immer wieder entgleitet, nennt er das Allereinfachste. Nur deshalb hat Bergson bis zum Lebensende geredet, weil er sah, dass es den Philosophen nie gelungen war, das unendlich Einfache zu sagen, und er es selbst nie vermochte, das zu formulieren, ohne sich gezwungen zu fuehlen, seine Formel zu korrigieren. Darin stimmt er mit Ludwig Wittgenstein ueberein.
Sind Sie in erster Linie Schriftsteller oder UEbersetzer?
Ich haette es nicht ein Leben lang ertragen koennen, Schriftsteller zu sein. Denn ich finde es bis auf den Fall von Peter Handke ungesund, vom Schreiben abhaengig zu sein, und ich haette mich total unfrei gefuehlt. Als franzoesischer Staatsbeamter, der an der Schule unterrichtete, war es dann doch bequemer. Die Republik ist ein gutes Maedchen, so sagen die Franzosen. Sie liess mir trotz Schule genuegend Zeit, in Freiheit ohne direkte Nachfrage zu schreiben. Als Universitaetsprofessor oder engagierter Schriftsteller haette ich nie wie ein freier Geist ohne materielle Abhaengigkeit sorglos schreiben koennen, sondern immer in Angstzustaenden hingelebt. Ich bin so etwas wie ein Privatgelehrter.
Was fehlte Ihnen zur Schriftstellerei?
Die Genialitaet und der Stoff. Ich bin nicht gross genug, um aus mir heraus zu treten, wie die ganz Grossen. Ich weiss nicht, ob mir die Genialitaet fehlt, sondern nur, dass ich sie nie gewollt habe, weil ich schon als kleiner Junge eine ungeheure Angst vor dem Leben hatte.
Wie kamen Sie ans UEbersetzen?
Als meine zweite Erzaehlung erschien, schrieb mir der franzoesische Kritiker Pierre Sipriot, der eine Radiosendung ueber meine Buecher machte, einen Brief, worin er bat, ihn anzurufen. Es amuesiert mich immer, zuerst die Stimme zu hoeren und dann den Koerper dazu zu sehen. Er sah gar nicht nach seiner Stimme aus. Auf jeden Fall sollte Michel Tournier Nietzsches Zarathustra uebersetzen. Da er aber ablehnte, sollte ich das uebernehmen. Das war, als ich zu lesen anfing, wieder so ein Schlag auf den Kopf. Als 18jaehriger lernte ich die Welt durch Lautréamont, Rimbaud und Nietzsche kennen, ein unglaubliches Erlebnis. Aus Anhaenglichkeit an meine Jugend habe ich den Auftrag sofort angenommen. Grundsaetzlich uebersetze ich nur, was sich mit dem Tiefsten meines inneren Wesens trifft.
Was unterscheidet den UEbersetzer vom Schriftsteller und den nach Worten suchenden Kunstvermittler vom Kuenstler?
Ein Bilderstau wartet nur auf den Zugang zur Sprache oder, im Fall von Malerei, auf dessen Sichtbarwerdung auf der Leinwand mit all ihren Verschiebungen, die aus der UEbertragung resultieren. Darin unterscheidet sich der UEbersetzer vom Schriftsteller, der Adept vom Autor und der Kunstrezipient vom Maler, nicht mehr.
Was Sie von Heidegger halten, ist bekannt. Bedenklich an der franzoesischen Rezeption sei, so sagen Sie, dass sie vehement das Nazistisch-Germanische des Philosophen mit einem Achselzucken als nebensaechlich abtaeten, weil sie den im Deutschen herauszuhoerenden Charakter seiner steinig-polternden, abweisenden Sprache der Unmenschlichkeit nicht erfassten.
So ist es. Zusammen mit Jean-Pierre Faye wollte ich damals Heidegger als echten Sprachnazi entlarven, und so habe ich ab und zu wie ein kleiner Hund mein Haeufchen in franzoesischen Zeitschriften wie Le Monde geschissen. Obgleich ich Sartres Schriften sehr schlecht kenne, ist mir immer wieder aufgefallen, dass es bei ihm vor Menschen wimmelt, wohingegen bei Heidegger hoechstens drei auftreten, aber was fuer welche. Alles sture Schwarzwaelder-Nazis. Heideggers Sprache ist das Schrecklichste, das ich kenne. Sein straffes Deutsch, dieses Nazideutsch, kommt hier am Pariser Bahnhof schoen eingepackt in wunderbarem Franzoesisch an. Leider ist in Frankreich Heidegger grosse Mode geworden, und es gab ganz viele Philosophen, die vom Nazismus-Problem abgesehen haben. Inzwischen hat sich das geaendert, und immer groessere Teile der franzoesischen Philosophen tendieren zur Tradition alter Klassiker wie Kant und Hegel und vor allem zu René Descartes zurueck.
Was verbinden Sie mit Nietzsches Also sprach Zarathustra?
Als Jugendlicher fand ich zufaelligerweise den Band einer Wehrmachtsausgabe zum Glueck ohne Hakenkreuz, zu der ich 1945 griff, weil in Frankreich kaum deutsche Buecher aufzutreiben waren. Als Achtzehnjaehriger fand ich das aus Treue zu mir selbst ueberwaeltigend, heute dagegen wunderschoen und zum Totlachen. Der letzte Teil mit den Tieren ist so laecherlich, schlimmer als Wagner, ein aufgepaeppeltes Deutsch. Aber fuer einen Jugendlichen, der ich war, entspricht diese Auflehnung gegen alles genau dem, was er braucht. Beim UEbersetzen fand ich die Sprache musikalisch so schoen, dass ich mich nie gelangweilt habe, obgleich ich beim vierten Buch, das einfach zu dumm, laecherlich und verschroben ist, wiehern musste. Aus Spass, wie schon bei Freud, habe ich mir dann den Eselstritt erlaubt und einen Satz hineingeschrieben, der nicht von Nietzsche stammt. Das muss ich immer machen, nur bei Handke traue ich mich noch nicht.
Es heisst, Bilder laegen Ihnen sehr am Herzen.
Eigentlich wollte ich Maler werden, weil mein Vater wie viele aus dem 19. Jahrhundert ein hervorragender Maler war, und als kleiner Junge habe ich ihm dabei zugesehen. Von Hitler als Oberlandesgerichtsrat zwangspensioniert, hat er dann wunderbar gemalt, und es draengte mich, es ihm gleichzutun. Aber aus ethischen Gruenden habe ich es aufgegeben, weil ich es unzumutbar gefunden haette, wenn meine Frau bueffeln muesste, damit ich, das grosse Genie, mich in mein Atelier zurueckziehen kann, um die Welt zu veraendern. Das ist so laecherlich an der Kunst.
Ist das Interesse an Kunst in gewisser Weise geblieben?
Was heisst Kunst? Das ist auch so ein Wort. Mit einem Freund habe ich um 1947 den Efeu auf van Goghs Grab abgesaegt, und wir haben dann sechs Monate spaeter das freibekommen. In der Schule wurde ich in die Geheimnisse der Kunstgeschichte eingefuehrt, und das hat mich stets begleitet. Wie gesagt, ich wollte selber Maler werden, aber ich bin in dieser Beziehung nicht kompetenter und nicht autorisierter als die Damen, die hier gerade am Café vorbeiflanieren. Dazu habe ich nicht mehr als andere zu sagen. Aber wie jeder, der sich mit Kunst irgendwie befasst, entwickle ich Ideen ueber Gesehenes. Allein schon deshalb, weil ich viel gezeichnet und gemalt habe. Wegen des Schreibens habe ich das ganz drangegeben, weil ich mir meine Bilder jetzt mit Worten erstelle. UEberhaupt glaube ich, dass Schreiben trotz Unterschiede dem Malen verwandt ist.
Inwiefern?
Meine eigenen Bilder uebersetzend, habe ich ein eigenes Fernsehen in mir, ja eine eigene Herstellungsfabrik, nicht wahr? Das funktioniert wunderbar, und die Bilder, die ich in mir trage, versuche ich in Sprache zu uebersetzen, um zu zeigen, was links oder rechts von mir steht. Das ist bei Ihnen sicherlich nicht viel anders, oder?
Ist die Funktion von Kunst und Literatur vergleichbar, wenn nicht sogar aehnlich?
Das ist nicht auf Anhieb zu beantworten. Zum Beispiel habe ich, weil ich oft in Museen gegangen bin, gewisse Konstanten entdeckt. Dabei stellt sich mir die Frage, wie es dazu kommt, dass z.B. in der deutschen Malerei des 14. bis 16. Jahrhunderts, die das ganze Roemische Reich, also auch Flandern und Holland ueberdeckt, also bei Breughel oder van Eyck immer diese rot-gruene Harmonie vorkommt. Im deutschsprachigen Raum taucht in vielen Bildern aus der Zeit stets ein rotes Kleid neben einem gruenen auf, und dieses Harmonieverstaendnis existiert in der franzoesischen Malerei nirgends. In Burgund kann das von Zeit zu Zeit wegen der kosmopolitischen Kultur, die es da gab, vorkommen. Aber der sogenannten franzoesischen Malerei ist diese Harmonie fremd, allenfalls finden Sie da Rot und Blau, also die Farben der Trikolore, die sich nicht aus Zufall aus diesen Toenen zusammensetzt, sowie Gelb und Blau. Es sieht so aus, als waere die europaeische Malerei, um es einmal pauschal auszudruecken, in zwei Richtungen aufgeteilt, naemlich in die erdhafte aus Rot und Gruen auf der einen und die unendliche auf der anderen Seite. Diese Aufteilung, von der ich da rede, kennzeichnet ganz tiefgreifende kulturelle Gegensaetze. Merkwuerdig daran ist, dass diejenigen, die diese erdene Malerei oder Malkultur vertreten, gleichzeitig auf etwas Intellektuelles aus sind. Die deutsche Malerei denkt, wohingegen die franzoesische Malerei, die es eigentlich tun sollte, nicht denkt, sondern vor allem malt. In der Tat ist das sonderbar, auch bedenkenswert. Wenn Sie die Entwicklung moderner Malerei verfolgen und deren Repraesentanten vergleichen, wobei ich jetzt weder an Paul Klee noch an August Macke denke, sondern an die Mehrzahl deutscher Expressionisten, die sich mit den franzoesischen Fauves so decken, dann lauern da eine innere Gewalttaetigkeit und Vehemenz, die aus der Materie herausragt. Die Tatsache, dass die Malflaechen einfach vom inneren Impuls weggetragen oder weggerissen werden, gilt fuer die franzoesische Malerei ueberhaupt nicht. Paul Cézanne hat einmal gesagt, Claude Monet sei nur ein Auge, das auf dem Kuechentisch liege. Aber was fuer eins! Das ist ein interessantes Phaenomen. Werfen Sie mal einen Blick auf das, was hochgekommen, also bekannt geworden ist. Natuerlich gibt es in Deutschland gute, aber kaum bekannte Maler wie Teubner oder Slevogt. Alles grossartige, ganz praezise malende Augen. Die anderen, die beruehmt geworden sind, haben alle Koepfchen und denken, und das ist das Obskure. Aber vergleichen Sie die denkenden Malphilosophen mit den bescheidenen, unscheinbaren Franzosen wie Pierre Bonnard, Jean Vuillard oder Georges Braque, die nur malen, ohne zu denken. So realitaets- und erdenverbunden die Franzosen mit dieser Blau-Gelb-Harmonie sind, so abstrakt, im philosophischen Sinne, malen die deutschen, in Rot-Gruen Verliebten. Fuerwahr ist das von mir eine stupide Verallgemeinerung, aber etwas daran ist wahr. Schauen Sie, die Haltung eines Ernst Ludwig Kirchner oder der Heutigen, die zwanghaft davon ausgehen, dass unbedingt ins Bild hineingehoert, was im Kopf geistert, teilen die grossen Franzosen nicht. Dafuer, dass vielleicht deren Kopf leer ist, haben sie ein unvergleichliches Auge. Denken Sie nur an Cézanne! Peter Handke hat nicht zufaelligerweise ueber ihn seine Lehre der Sainte-Victoire verfasst. Das, was ich sage, versteht sich nicht als Kritik an deutscher Malerei. Mich reizt nur der Vergleich wegen der Spannung, die sich da ausdrueckt. In diesem Kontext beachte ich nicht das Gros heutiger Malerei. Da sie sich derart internationalisiert hat, ist sie zu konfus, voellig verschwommen und fuer uns eigentlich undefinierbar. Aber es lohnt sich, sich staerker mit der Malerei der 30er Jahre oder auch davor zu befassen, also mit Schmidt-Rottluff, Pechstein, Mueller oder Lehmbruck, wo das Expressive so herausplatzt, als ob da eine Weltsicht oder ein Weltbild mitenthalten waere, nicht wahr? Das geht dann wieder nach Flandern, und die Mittelloesung dazu ist diese unglaublich verkannte, ungeheure belgische Malerei, also Spillaert, James Ensor und Paul Delvaux. Interessant ist, wie Flandern den UEbergang dazu darstellt. Ich weiss, wieviel UEbertreibung in der Verallgmeinerung steckt, die ich gerade leiste, aber es reizt mich einfach auf voellig ueberzogener Ebene, die rein deutsche und rein franzoesische Malerei mit deren UEbergangszonen zu vergleichen. Daraus liesse sich vielleicht ein Ansatz ableiten, um der Kunstgeschichte eine neue Richtung zu geben.
In welchem Verhaeltnis stehen Auge und Geist zueinander?
Das Auge ist nicht dazu da, zu denken, es sieht vor allem. So gesehen, ist die Malerei in erster Linie ein Sehen, kein Denken, zumindest aus meiner Perspektive. Deshalb wittere ich in der deutschen Kunstgeschichte ein grosses Problem. Ich frage mich, warum Franz Marc so viel bekannter als August Macke ist? Natuerlich, weil er denkt und sich ein Weltbild oder, wie die Franzosen sagen, eine Weltanschauung erzeugt hat, wohingegen die ganz grossen Maler eigentlich ganz andere sind. Ich denke dabei an erste Bilder von Max Slevogt, an Hans Thoma, an die bayerische Malschule des 19. Jahrhunderts, also an diese Landschaftsmaler, an Koch oder sogar Richter. Diese Leute haben sich in Bescheidenheit geuebt, was bereits Goethe bemerkte, der Carus mehr, weniger Caspar David Friedrich liebte. Warum? Weil da ohne hohe Ansprueche das Auge, das malt, auf den Tisch gelegt wird. Malen ist eben kein Denken, und ich frage mich, warum die Tendenz ins Geistige in Deutschland so verbreitet und diese urspruengliche Naivitaet, diese Kindlichkeit verlorengegangen ist. Die expressionistischen Maler sind lauter unglueckselige Menschen, die sich stets eine Welt ermalt haben, durch deren Dschungel man nie hindurchkommt. Da steckt immer ein Gedanke dahinter. Der einzige franzoesische Maler aus der Zeit, der mit den deutschen auf gleicher Stufe steht, ist Georges Rouault. Aber alle anderen arbeiten und befassen sich nicht einmal bewusst mit Form- und Farbproblemen, sondern malen vor sich hin. Tausende von Bildern, bis sie das beherrschen. Ich kenne einen 86jaehrigen Maler, naemlich Armand Petitjean, der bei mir in der Naehe wohnt, ein Abstrakter. Als er mich vor kurzem besuchte, erzaehlte er mir, jetzt damit anzufangen, einige Fortschritte zu machen, weil er nun dahinter gekommen sei, was Malerei heisse. Das sagte mir einer, der seit ueber 70 Jahren beinah taeglich ins Atelier geht, um zu malen.
Ist Ihnen Sehen wichtiger als Denken?
Natuerlich, denn zu sehen, dazu bedarf es der Schulung, waehrend Denken heute jeder zu koennen glaubt. Fuer mich teilt sich Kunstgeschichte eben in zwei Zonen auf, in die denkende und die sehende. Aber aufgepasst, Sehen ist viel schwieriger als Denken, weil es verlernt, ja nie richtig gelernt wurde, waehrend die Einfuehrung in die Macht der Begriffe rasch erfolgt und der Umgang damit fuerchterlich ueberbewertet wird. Nun steckt das Sehen noch in den Kinderschuhen, weil es immer schon, ja àpriori ein funktionelles ist. Ich sehe hier eine Schublade, die dazu dient, dass ich dahinein etwas unterbringe. Ein Maler dagegen wuerde keine Schublade sehen, sondern Farben, die es zu kombinieren gilt, damit das auch zusammenhaengt. Davon ist bereits in dem beruehmten, vor dem Krieg geschriebenen Traktat ueber Landschaftsmalerei von André Lhote die Rede. Er ging der Frage nach, wie aus Grau Blau wird, welche Nebenfarben dazu noetig sind und warum Cézanne, wenn er ein Haus malt, die Perspektive verrueckt, davon ausgehend, dass dies abhaengig davon ist, dass eine Farbe heller als die andere ist. Das sind die grossen Probleme jener Malerei, der es weniger darum geht, wie sich die Welt veraendern laesst.
Mit Peter Handke verbindet Sie ein fruchtbares Misstrauen gegenueber dem Geist, der klischiert und schematisiert, und ein ergiebiges Vertrauen in ein Sehen, das gleichzeitig erkennt. Kommt es demgemaess darauf an, mit den Augen zu schreiben?
Natuerlich fuehle ich mich Handke deswegen so eng verbunden, weil in seiner bildnerischen Literatur das rein Optische ein so starkes Gewicht hat und so phantastisch ausgepraegt, ja dominant ist. Es herrscht eine optische Bescheidenheit vor, die er mit Malern gemeinsam hat. Eigentlich koennte ein Maler sein Leben lang einen Stuhl in einem Garten malen und darin jeden Tag etwas Neues entdecken. So sehe ich Monet mit seinen Hocken nach der Ernte auf den Feldern. Problematisch an deutscher Kunstgeschichte ist deren enormer Hang zur Interpretation, was nicht ausschliesst, dass ich auch einen Maler wie Duerer genial finde. In Museen von Bild zu Bild gehend und so von Epoche zu Epoche springend, merken Sie sofort, was nordlaendische von suedlaendischer Malerei unterscheidet. Ein widerspruechliches Beispiel dafuer ist Edvard Munch, der zufaelligerweise ein absolut geniales Auge hat. Auch bei Nolde ueberwiegt das Malerische. Bezeichnend, dass im Werk vieler Kuenstler das Gefuehl eine so ungeheuer wichtige Rolle spielt.
Was bedeutet Ihnen Handke noch?
Auf Anhieb verstanden wir uns wie Kinder im voelligen Einvernehmen, unterhalb der Woerter. Man kann ueber Handke nichts sagen. Diese Abwehr hat er mit ungeheurer Intelligenz entwickelt. Dabei ist kein Mensch so zartfuehlend fuer die anderen wie er, aber dagegen wehrt er sich. Gehaessigkeit gibt es bei ihm nicht, aber Gewalttaetigkeit. Im uebrigen kenne ich keine Buecher, die politisch so weit gehen wie seine. Es gibt wenige Schriftsteller, die den Anderen derart zur Freiheit bringen. Mit seiner Haltung ist er im Sinne des Buches von René Girard Das Ende der Gewalt. Nur manchmal, wenn er sich in Wut versteigt, faellt er wieder diesem Machtdenken zum Opfer.
Wie weit darf man gehen im Urteilen ueber Andere?
Wissen Sie, jeder denkt ueber den anderen alles moegliche, nur dass er es nicht immer zum Ausdruck bringt. Da ist vielleicht die Trennlinie, wo der Takt anfaengt. Problematisch wird es dort, wo jemand seine Stellung so sehr ausnutzt, dass sie zur Macht wird. Ein Schriftsteller, dessen Wunderwerk wahrhaftiger Menschenbefreiung doch nur ein stetiges Ankaempfen gegen die Versklavung ist, sollte niemals Macht ausueben. Aus dem Denken darf nie ein Machtanspruch werden, und darum ist es gut, wenn man sich staerker auf ein Sehen verlaesst, das man von Malern wie von Bildhauern lernen kann. Sich in Bilder zu vertiefen, die vom Auge gezeugt wurden, hilft einem vielleicht dabei, ein Denken jenseits des Willens zur Macht auszubilden. Macht und Denken sind unvereinbar, und das Denken steht der Macht immer als solches im Wege oder sollte es. Wer in so eine Gewalt, so gering sie auch sei, hineingleitet, ist verloren.
Nun verspricht sich Handke von der Moeglichkeit eines offenen Auges mehr Frieden.
Das auch, nur verspricht er sich das nicht, denn er hat kein Programm. Es ist gewiss eine Tatsache, dass das Sehen alles aus der Funktion herausreisst und dadurch einen befreienden Charakter hat. Durch das Auge, das sich nur auf sich selbst verlaesst, wird die Welt entfunktionalisiert. Aber zum Programm erhoben, ist es zum Scheitern verurteilt. Denn sobald man sich etwas vornimmt, ist es aus. Es gibt bei Handke auch ab und zu den Hang, sich selber zu programmieren, aber ich glaube nicht, dass er die Welt veraendern will. So etwas wie ein Programm hat und will er auch nicht. Das ist ihm von vornherein suspekt. Vor jenen, die Programme machen, habe ich ausserdem Angst. Ich glaube, Handke sieht die Gegenstaende einfach, wie er es bereits in Das Gewicht der Welt, ja in all seinen Buechern dargelegt hat. Er legt einfach das Auge auf den Tisch. Befragt danach, ob er die Welt veraendern will, so ist das zu verneinen. Ich jedenfalls moechte es nicht.
Als was verstehen Sie seine Lehre der Sainte-Victoire?
Einfach als eine wunderbare Beschreibung des Ortes, wo Cézanne gemalt hat, und er wollte da leiblich die Landschaft nach Cézanne erleben, aber gewiss keine Welt verbessern. Das ist ein Lob der Gegenwart, wozu ein wunderbarer Brief von René Char passt, den er mir schickte. Darin sagt er, dass sich bei Handke ein Sehen ausspricht. Auf seinen Sohlen ist er den Bildern nachgegangen, so wuerde ich das formulieren, und zwar absichtslos.
Gedankensprung, in Ihrem Essay Der bestrafte Narziss sprechen Sie von dem Denken, das sich immer wieder in dem, was es nicht ist, verliert, und den Spuren im Kunstwerk, nach denen wir fragen, und dem Geschoepften, das am Endpunkt seinen Ursprung vergisst. Liesse sich das ein wenig erklaeren?
In der Tat rede ich da davon, wer redet, wer malt, wer schreibt und wer zuhoert. Immer ist es jemand, denn das Denken redet nicht; wer redet, ist dieses in IHM, dem Redenden eingeschlossene Ich, um so mehr, als seine Stimme laut genug ist, um das, wovon es redet, zu uebertoenen. Jedem Schoepfen liegt diese Besonderheit zugrunde: Zugleich Ursprung und Endpunkt, vergisst das am Endpunkt angelangte Werk seinen Ursprung. Das Gedicht ist nur noch die Asche seiner einst gewesenen Inspiration: Das vollendete Werk sagt, was es in Wirklichkeit soeben zu sagen aufgehoert hat. Wenn nun das Lesen eine dem Schreiben vorangehende, dichte und dauerhafte Flamme (- das naemlich, was sich nicht erschoepft, sondern im Lesen deutlich wird -) nicht zurueckfindet, wenn nun ein Betrachten, das den Blick des Malers nicht wiederfindet, so besteht die Gefahr, dass nicht gelesen und nicht gesehen wird. Vom Autor, der das Werk schafft, oder vom Maler, der das Bild malt, oder vom Bildhauer, der die Skulptur macht, finden wir die Spur nur im Werk selbst. Trotzdem sind wir mit Leidenschaft dabei, alles ueber Proust, ueber Cézanne, ueber Giacometti, Schubert oder Kafka zu ermitteln. Beinhaltet dies aber nicht, den umgekehrten Weg einzuschlagen, durch das Werk hindurch zu seinem Autor, auf seine Seite ueberzuwechseln, um diese Inspiration, dieses Durchsickern des Ich, aus dem das Werk entstand, wiederzufinden? Heisst das nicht, dass wir derjenige, der er damals war, sein moechten, und sei es auch nur fuer einen einzigen Augenblick? Zum anderen werden wir uns in jenen verwandeln, der wir nicht sind, und das, ohne aufzuhoeren, der zu sein, der wir sind. Hier beginnt vielleicht die wahre Reise, zu der uns Jacques Lacan in jenem herrlichen Satz am Ende von Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion auffordert: als ob der andere mich zurueckspiegelte, er zu sein.
Was heisst das, bitte?
Ich frage mich: Wer ist das Gesicht, das mich anblickt? Moechte man nicht beim Betrachten von Portraets am liebsten zwischen die Leinwand und die Malfarbe schluepfen, um dieses Gesicht zu sein? Koennte ich mich innerhalb meines Gesichts befinden, fuehlen, wie die Hitze der Scham in meinen Wangen aufsteigt, und zugleich einer von denen sein, die um mich herum stehen und mich erroeten sehen, so haette sich das Problem geloest, dem die Menschheit staendig hinterherrennt und durch das sie ueberhaupt als Menschheit bestaetigt wird: Wie ist man zugleich man selber und ein anderer? Ich sehe meinen Blick, alles kann ich sehen, nur mich nicht. Alle Galaxien vermag ich zu entdecken, alle moeglichen Welten, mein Auge kann das Himmelsgewoelbe umfassen, aber meinen Blick kann ich nicht sehen: Unaufhoerlich bilde ich dessen Ursprung, muss ich durch meine Augen sehen. Alles kann ich, nur nicht, mich selbst ueberspringen, nur nicht hinter mich tauchen. Ich bin von Anfang an und unwiderruflich der ich bin, geworfen in den, der ich bin, und das hindert mich fuer alle Zeiten daran, ein anderer, der mich saehe, zu sein.
Was folgt daraus fuer unser Wahrnehmen von Kunst?
Empfaenger eines Werks ist man nur, indem man das Geschaffene in sich traegt: Fuehlt man das Werk, ist man davon ergriffen, so deshalb, weil es in uns zur Keimform gemaess Etienne Gilson geworden ist. Es bewirkt, woraus es entstand. Als ob das Ich, um ICH zu sein, gezwungenermassen in das, was es nicht ist, umkippen muesste. Dieser Weg verlaeuft stets in gleicher Richtung: Es gibt kein Empfangen, das nicht gibt, kein Werk, das nicht schafft, alles ist hervorgegangen, wie der Blick. Aber: der Blick sieht, kann sich jedoch dabei nicht sehen, er kann sich nicht selbst gegenueberstehen. Wie mit dem Spiegel verhaelt es sich auch mit der Kunst: Erwartet man von ihr nicht dieses winzige und doch unendliche Ausloesemoment, bei dem sich das Ich in jenen anderen umkehrt, die umgekehrte Faszination eines Gegenspiegels? Sucht man nicht, beim Betrachten so vieler Portraets, deren Unschuld festzuhalten, jenes Wissen um sich selbst, das der Portraetierte in sich barg? Ich glaube, dafuer spricht einiges.
Noch einmal einen Gedankensprung, wenn Sie erlauben: Was waere eigentlich das Malerische an der Literatur?
Mir selbst, wenn ich schreibe, liegt daran, von ganzem Herzen mit den Augen zu schreiben. Eine leidenschaftliche Sehnsucht, mehr zu sehen und mit Worten Bilder zu erzeugen, spuere ich auch bei Gustave Flaubert, Franz Kafka und natuerlich bei Goethe. Bei denen hat sich das Auge eine erstaunliche Praesenz erobert. Alles bei Goethe kommt aus dem Sehen. Ihn richtig lesend, ist zu beachten, wie er stets mitteilt, was rechts und links steht. Alles ist da total im Raum situiert. Auch Gottfried Keller, Hans Fallada oder Hermann Lenz erzeugen in der Sprache immer Orte auf imaginaerer Linie. Die Ortung ist ein schoenes deutsches Wort, um deren Tun auszudruecken. Grossartig ist, zu erleben, wie bei Heimito von Doderer in Die Strudlhofstiege alles im Raum steht. Lenkt er die Aufmerksamkeit auf eine lange Kutschen-Schlange, so verliert man, wenn die vorne losfaehrt, die hintere nie aus den Augen. Er ist ein Meister der Ortung, der zeigt, wie alles im Raum plaziert ist, aber auch Edward Hopper ist ein Spezialist, was die Ortung angeht. Klar, dass sowohl die Literatur wie die Malerei nicht immer im Raum steht, soll sie auch nicht. Aber ich selber brauche das Sehen sowie den Bezug zum Koerperhaften. Es existiert keine Trennung zwischen Leib und Seele. Es liegt da so etwas wie eine deutsche Versuchung vor, das eine vom anderen zu loesen. Symptomatisch auch, dass Woerter wie Bewusstsein und Gewissen im Deutschen getrennt sind, waehrend es dafuer im Franzoesischen nur ein Wort gibt. Das ist kein Zufall.
Nun gibt es ja in Frankreich literarische Richtungen wie den Nouveau Roman.
Ja, doch kenne ich mich da nicht so gut aus.
Dafuer aber um so mehr bei Albert Camus, auf den sich Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute oder Michel Butor auf ihre jeweilige Weise berufen. Alle genannten Literaten plaedieren fuer die Kunst des inneren oder aeusseren Sehens. Camus Lehre von der Nutzlosigkeit, alles erklaeren zu wollen beruht auf eine auf ein offenes Sehen zielende Aversion gegenueber jenen Begriffen, die Erscheinungen wegschematisieren.
Darin treffe ich mich mit Camus, worauf ich ein bisschen stolz bin. Noch mehr am Herzen liegt mir Antoine Artaud, den ich gerade wieder lese, von dem die folgende, mir wichtige Passage stammt: Die ganze nicht zufaellige, ins Blaue hineinzielende Wissenschaft der Menschen ist nicht der unmittelbaren Erkenntnis ueberhoben, die ich von meinem Wesen habe. Ich bin der einzige, der ueber das urteilen kann, was in mir ist. Damit drueckt er aus, wie sehr er Ideen missachtet, und fuer dieses Misstrauen gegenueber Ideen, die Erscheinungen wegoperieren, finden sich auch in der Malerei schoene Beispiele von Dauer. Nun alles, was ich gerade in den luftleeren Raum stelle, indem ich mich aeussere, sind vielleicht voellig unbegruendete Hypothesen. Klar, aber trotzdem wage ich das einmal. Apropos so beruehmte Maler wie Otto Dix oder Max Beckmann, ueber deren Weltsicht und deren Ansichten des Weltgeschehens liessen sich zig Buecher vollschreiben. Aber ob das wirklich von der Malerei erwartet werden kann, dass sie sich so einmischt, frage ich mich. Ich weiss es nicht. Mir gefaellt da mehr die Bescheidenheit in der Malerei, so auch der heute voellig belaechelte, gar verkannte Spitzweg, der als ein Vorfahre der Impressionisten darauf aus war, alles vor allem malerisch zu gestalten.
Es gibt ein Problem, das Essayisten, Schriftsteller, Maler und UEbersetzer gleichermassen verbindet, naemlich das Problem der UEbersetzung. Um es zu konkretisieren, einmal die Frage: Wie schafft es der Maler, einen Raum auf der Flaeche so zu imaginieren, dass wir beim Sehen das Gefuehl haben, uns mit den Augen in Raeumen zu bewegen.
Sie lenken auf einen unueberschaubaren Komplex, und ich kann Ihnen da nur indirekt antworten. Darueber, welche Folgen sich aus der Unuebersetzbarkeit des Deutschen ins Franzoesische ergeben, schrieb ich ein Buch, betitelt mit Quand Freud voit la mer, also Als Freud das Meer sah. Damit weckte ich bei den Psychoanalytikern viel Aufmerksamkeit. Nun, worum geht es mir da? Ich versuche den Franzosen zu erklaeren, wie die deutsche Sprache funktioniert, und jetzt ist ein weiterer Versuch erschienen. Mit dem neuen Titel Wenn Freud auf das Zeitwort wartet spiele ich darauf an, dass der deutsche Satz stets mit einem Zeitwort endet. Jetzt zu meiner indirekten Antwort: Wenn Sie einem Franzosen sagen: Donnez moi le cadenas!, ohne dass der weiss, was Sie damit meinen, so reicht er Ihnen einen Aschenbecher oder irgend etwas. Fordern Sie dagegen einen Deutschen auf, Ihnen ein Vorhaengeschloss auszuhaendigen, so ist sofort klar, was Sie wollen, weil die deutschen Woerter die Realitaet genauer umgrenzen, beschreiben oder lokalisieren, wohingegen die franzoesischen oft nicht erkennbar sind. Erstens weil sie dem Lateinischen, also einer sogenannten toten Sprache entstammen und weil die Woerter nicht immer auf der Beschreibung beruhen, sondern auf der Bezeichnung. Im Franzoesischen koennen Sie weder hin und her noch auf und ab sagen, aber dafuer verfuegen die Franzosen ueber allgemeine Woerter fuer alles, was nach oben und nach unten geht, naemlich monter und descendre. So etwas wie Raumformulierung interessiert die franzoesische Sprache ueberhaupt nicht, und da frage ich mich, ob diese Art Freiheit dem raeumlichen Gehabe gegenueber nicht auch das Auge befreit und ob das deutsche Auge in der unheimlichen Praezision der Sprache nicht irgendwie belagert ist. Mit Ausgang und Ausfahrt ist alles so praezise und genau umrissen, dass Sie aus dieser Wirklichkeitsbeschreibung nicht mehr herauskommen koennen. So stellt sich mir die Frage, ob gewisse Maler nicht Gefangene der Sprache sind, da sie noch keine Mittel gefunden haben, nicht mehr zu denken, um von sich zu sagen: Ich stehe da und bin das Auge auf dem Kuechentisch. Dagegen laesst, wie ich vermute, die franzoesische Sprache mit ihrer unheimlichen Gleichgueltigkeit gegenueber der Realitaet dem Maler viel mehr Freiheit. Innerhalb der deutschen Musik, die ja herausragt, bestehen derartige Probleme nicht, weil ihr die Sprache nicht im Wege steht. Das Grossartige, die gesunde Reaktion und die unglaubliche Kapazitaet deutscher Sprache besteht dagegen darin, Fremdwoerter assimilieren zu koennen. Natuerlich stellt sich dieses Problem jetzt laengst nicht mehr so dar, und so rede ich hier vor allem vom 19. Jahrhundert, als grosse Sektoren des deutschen Geisteslebens diesem Reinheitsfimmel unterlagen und die Muttersprache so gepflegt wurde. Doch scheint mir, dass es so etwas wie einen Sprachkerker gibt, obgleich heute eine Auflockerung der Sprache durch Fremdwoerter zu beobachten ist.
Noch einmal Sigmund Freud, was an ihm reizte Sie?
Nicht das Analytische, nur das Sprachliche, also die Frage, wie es dazu kommt, dass er auf franzoesisch voellig unverstaendlich und auf deutsch voellig klar ist. Was zirkuliert also unter uns Menschen an unerfassbarer Anonymitaet? Ich spreche hier von Unfassbarem, das uns durchzieht und von dem wir nichts ahnen. Das ist Freud.
Was halten Sie von Maurice Merleau-Ponty, der auf den Spuren von Paul Cézanne eine Phaenomenologie des Sehens entworfen hat?
Von ihm weiss ich nur, dass er Kreppsohlen trug. Als Student suchte ich nach einem anderen Philosophen und gelangte des oefteren per Zufall in seinen Hoersaal. Bemerkend, dass er auf Kreppsohlen ging. Von ihm habe ich nie ein Wort gelesen. Mir ist er nur vom Sehen bekannt, insofern kann ich das, worueber er schrieb, nicht beurteilen. Er war gross, sympathisch und anscheinend sehr witzig. Das ist das einzige, was ich von ihm weiss. Man muesste etwas von ihm lesen, aber ich habe es eben nie getan.
Ich frage danach nicht nur, weil er ueber Cézannes Auge schrieb, sondern auch, weil er sehr stark ueber die Abhaengigkeit unseres Seins von der Koerperlichkeit reflektierte.
Ich weiss, aber ich kann nichts darueber sagen.
Zwei Begriffe, derer Sie sich oft bedienen, sind Ortung und Koerperlichkeit.
Ja, vielleicht kommt das von meinem Vater. Ich war ein unglaublich nervoeses, auch unmoegliches, staendig agitiertes Kind. Aber mit dreizehn Jahren, in meinem Heim, konnte ich stundenlang am selben Platz sitzen und schauen.
Was hiess Koerperlichkeit in jungen Jahren?
Um es deutlich zu machen, so muss ich bekennen, dass ich 1944, also mit 16 Jahren, in diesem Kinderheim homoerotische Erlebnisse hatte. Ich dachte an nichts anderes mehr. Goettlichkeit war fuer mich Sexualitaet. Sie hat mir das Leben gerettet. Fuer mich ist sie eine Form der Andacht und faellt mit einer nie mehr zu vergessenden Lebensbegeisterung zusammen. Im Franzoesischen gibt es ein herrliches Buch mit dem Titel Der Zauberlehrling von François Augiéras, der da so etwas wie eine Heiligung des Koerpers vornimmt. In der fuerchterlichen Geschichte der grossen Missdeutungen des Christentums ist die Verteufelung des Koerpers die tragischste. Nirgendwo in der Bibel oder im Evangelium ist die Rede von der Verurteilung des Koerpers. Eben das Gegenteil ist der Fall. Der Leib ist, solange ich existiere, immer da. UEberallhin kommt er mit. Ich werde ihn nie los. Nirgendwo laesst er sich abstellen. Es gibt folglich kein reines Denken. Die leibliche Gegenwart, das rein Auf-koerperliche-Empfindung-ausgerichtet-Sein ist die Wortlosigkeit der Sprache, wo jedes Wort uns auf Reales, also auf die Praegnanz materieller Gegenwart und Existenz der Umwelt zurueckwirft. Ohne sie ist weder Malen noch Schreiben denkbar, und weil die Praesenz des Koerpers unhintergehbar ist, sind mir sowohl eine Malerei als auch eine Bildhauerei und Literatur wichtig, die das nicht aus dem Auge verliert, sondern darauf aufmerksam macht, dass der Blick, der auf etwas geworfen wird, am Koerper und dessen Plazierung im Raum gebunden ist.
Schauen, von dem Sie vorhin sprachen, hatte welche Bedeutung?
Keine, ich schaue einfach. Wissen Sie, was mich stets in Panik versetzt, das ist die staendige Interpretation. Vor der fuerchte ich mich. Das finde ich eine Indiskretion, auch Dichtung finde ich obszoen. Also ich kann stundenlang irgendwo sitzen und sehen. Nichts ist schoener, auch unverfaenglicher.
Ist Ihnen die ekstatische Struktur des Sehens fremd?
Nicht fremd, aber sie geht mir schon wieder viel zu weit.
Wenn man darunter das Aus-sich-Heraustreten verstuende, also eine Form der Selbstvergessenheit und des Bei-den-Dingen-Seins, wie waere das dann?
Das ist vielleicht moeglich, aber nicht so ohne weiteres. Fuer mich waere das Blindwerden eine absolute Katastrophe, weil ich mit dem einfachen Sehen so etwas wie ein Gluecksgefuehl verbinde. Sehen ist Welt. Ob das Bedeutung hat oder nicht, ist mir egal.
Apropos Blindheit, Sie kennen Evgen Bavcar?
Ja, wissen Sie, ich schaeme mich direkt. Wir haben uns sehr oft telefonisch unterhalten, und ich bin immer zu faul gewesen, um ihn zu treffen. Paris ist so gross und weit, dass ich nie bei ihm gewesen bin. Bavcar, der denselben Verleger wie ich hat, deckt hochinteressante, viel zu wenig beachtete, voellig ignorierte Probleme auf, die mit dem dritten Auge und dem inneren Blick zu tun haben, wenn er ueber das blinde Sehen schreibt und redet. Wahrscheinlich kennen Sie Den Brief ueber die Blinden von Diderot, in dem dieser sich mit dem Grundempfinden der Leiblichkeit durch das Sehen befasst. Es geht mir stets um die Art, wie wir so etwas wie die Kontinuitaet mit der Welt und dem Raum herstellen. Meine Frau amuesiert es immer, dass ich, sobald ich eine Bank sehe, was mir vor allem in Deutschland widerfaehrt, darauf Platz nehme, um nichts anderes zu tun als zu sehen. Mir tut es gut, stundenlang nur auf eine Landschaft oder auf nur einen Platz, wie diesen hier in Paris, zu schauen. Da ist immer etwas los, selbst wenn nichts los ist. Das Auge ist dauerbeschaeftigt und empfaenglich fuer minimale Lichtaenderungen, die wandernden Schatten und den Anblick der Dinge, deren Farben sich mit dem Stand der Sonne und dem Auftreten von Wolken und deren Verschwinden aendern. Alle fuenf Minuten erscheint das Licht doch total anders. Noch nie in meinem Leben habe ich Tage erlebt, wo das Licht sich gleich geblieben waere, und das ist grossartig fuer uns, die sehen. Das ist, was ich als Weltoffenheit bezeichnen wuerde und worauf es sowohl Malern wie Literaten ankommt, die als Augen von Ort zu Ort ziehen.
Beinhaltet das Sehen, dem Sie sich zuwenden, so ein behagliches Gefuehl von Koerperlosigkeit?
Aus meinem Buch Der bestrafte Narziss ueber Masochismus hat der Verleger Ammann einen Satz des franzoesischen Philosophen Jourbert als Deckeltext zitiert. Dieser, ein grosser Freund von Chateaubriand, hat einmal geschrieben: Es ist, als ob die Seele den Koerper in ihrer Mitte haette. Genau so empfinde ich das.
Worum geht es in Ihrem Essay?
Um Masochismus, die Koerperstrafe in meiner Kindheit und darum, dass die Strafe in ihr Gegenteil als Begeisterung umschlaegt. Damit wollte ich alle Obrigkeit unterhoehlen. Alles Autoritaere muss bekaempft werden, und drum bin ich im Innern meines Herzens ein leidenschaftlicher Anarchist.
In Das Sein und das Nichts setzt sich Jean-Paul Sartre mit der Dialektik von Sadismus und Masochismus auseinander.
Das habe ich nie gelesen. Ich muss Ihnen mal eine so wahre wie bezeichnende Geschichte erzaehlen. Kurz, vielleicht drei oder vier Monate nach Erscheinen von Sartres Werk kam so ein armer Schlucker mit schaebigem Regenmantel bei Gallimard vorbei, so ein kleines Professoerchen, ganz schuechtern, und sagte: Ja, meine Damen und Herren, ich besitze Das Sein und das Nichts , und da ist wohl ein kleiner Irrtum passiert, denn das Buch springt von Seite 150 direkt auf Seite 290. Koennen Sie mir das bitte ersetzen? Daraufhin ging jemand in den Keller ein neues Exemplar holen. Alle ueberpruefend, stellte er fest, dass jedes Buch den gleichen Fehler aufwies. Da war dann klar, dass saemtliche Kritiker, die ausfuehrlich das Buch rezensiert hatten, es offensichtlich nicht und nur zum Teil gelesen hatten. Denn keinem war aufgefallen, dass es falsch sortiert war. Kaum jemand ist weiter als bis zur Seite 150 vorgestossen. Eine schoene Anekdote, nicht wahr? Diese erste Ausgabe soll heute eine bibliophile Raritaet sein.
Kannten Sie Sartre?
Ich habe ihn einmal gesehen. Ein unglaublich liebenswuerdiger Mensch, dem ich einmal Wolf Biermann vorgestellt habe, aber am Ende seines Lebens in einem Cadé in der Naehe der Sorbonne. Da ging es ihm schon sehr schlecht. Nun, ich habe einiges von ihm gelesen. Nur an Das Sein und das Nichts habe ich mich nie rangetraut. UEber 800 Seiten zu lesen, das ist einfach zu viel verlangt. Ich bin der Ansicht, dass es kein Verleger zulassen sollte, dass Buecher mehr als 300 Seiten umfassen. UEber Jahre habe ich honorarlos bei der Zeitschrift Quinzaine Literaire aus Freundschaft zu Maurice Nadeau gearbeitet, dem Autor eines Buches ueber den Surrealismus. Der hat einen gluecklicherweise dazu gezwungen, auf wenig Raum moeglichst viel auszudruecken, indem er einem nie mehr als vier Manuskriptseiten abnahm. Es ist eine gute UEbung, gezwungen zu sein, in wenigen Zeilen Gedanken ueber Kunst oder Literatur festzulegen. Sie kennen doch das schoene Wort eines Franzosen aus dem 17. Jahrhundert, der sich fuer die Laenge seines Briefes entschuldigte, indem er darauf verwies, keine Zeit gehabt zu haben, sich kuerzer zu fassen.
Zurueck zu dem zitierten Satz: Es ist, als ob die Seele den Leib in ihrer Mitte enthielte.
Damit ist gemeint, dass Leib und Seele dasselbe sind. Ich stehe hier, wie es Artaud immer sagte, und bin die Mitte des Raumes, der sich um mich herum ausbreitet; und das gilt auch fuer den Maler, der da sitzt und alles um sich herum ortet.
Wie stiessen Sie auf Artaud? Welche Bedeutung hat er fuer Sie?
Ich gehoerte zu den Jungen am Gymnasium, die um 1947 viel von und ueber ihn gelesen haben. Mein Leben lang hat er mich begleitet. Wie das sicherlich auch in Deutschland ueblich war, uebten wir uns darin, Gedichte zu schreiben. Das war die Zeit, wo wir achtzehnjaehrig der Literatur verfielen. An so gut wie jedem franzoesischen Gymnasium gab es einen kleinen Club der Dichter. Ja, wir waren in einem Zustand der Exaltation, und da kam uns Artaud entgegen, schon allein wegen seines Theaterskandals, wo er diese fuerchterliche Selbstinszenierung mit hysterischem Geschrei veranstaltet hat und als einziger ihm der alte André Gide zur Hilfe kam, vor einem in Peinlichkeit erstarrten Zuschauerraum. Daneben beeinflusste uns ausserdem Arthur Rimbaud. UEbrigens ist er ziemlich verkehrt ins Deutsche uebertragen worden.
Wieso?
Der Anfang des Gedichts Being Beauteous, naemlich Le canon sur lequel je dois m abattre wurde mit kanonischer Satzung uebersetzt, wohingegen es aber um das maennliche Glied geht. Das Sexuelle wurde verdraengt, geflissentlich uebersehen. Rimbaud, der junge Onanierer, spricht doch von nichts anderem als von Sexualitaet. Im Grunde ist das eine Zensur bei den deutschen UEbersetzern. AEhnliche Faux pas gibt es bei Jean-Jacques Rousseau. Wenn er schreibt Ich hatte (aus Italien) wenn nicht meine Unbeflecktheit jedoch meine Jungfraeulichkeit zurueckgebracht, so wird daraus beim verkrampften deutschen UEbersetzer: Ich hatte, wenn auch nicht meine seelische Unberuehrtheit, so doch meine koerperliche Keuschheit zurueckgebracht. Sexuelle Verdraengung ist wiederum auch das Problem deutscher Malerei. Vielleicht gibt es in der Malerei so eine kindhafte Schuldigkeit. Solche Aussagen, wie gerade von mir formuliert, sind stets mit Vorsicht zu geniessen, da sehr pauschal. Allgemeinheiten jeder Couleur, auch die zur Malerei, darf man nie gelten lassen, sind immer zu hinterfragen.
Die Parallelen zwischen Kunst und Literatur hatten wir gestreift. Wo sehen Sie die Unterschiede?
Das laesst sich nicht so leicht formulieren. Der Literat schreibt, der Maler malt. Man kann viel ueber Malerei schreiben, aber nicht ueber Literatur malen. Aber solche Vergleiche aengstigen mich ein bisschen. Merkwuerdigerweise kann man Malerei kommentieren, aber sowohl Malerei wie Musik sind in sich so geschlossene Systeme, dass Sie darueber soviel reden koennen, wie Sie wollen, ohne es dadurch zu veraendern. Das bleibt voellig gleichgueltig. Den Bildern ist es egal, was ueber sie ausgesagt wird.
Mit keiner Sprache lassen sich Bilder wiederherstellen.
Genau, aber auch die Literatur laesst sich mit Reden nicht wiedergewinnen. Sie koennen Kafka noch so ausfuehrlich kritisieren, aber der beste Kommentar ist Kafka selber, also das Kunstwerk; und Sie koennen ueber van Gogh noch so gut schreiben. Keiner sagt mehr ueber ihn aus als er mit seinen grossartigen Gemaelden, also mit Kunstwerken. Nur mag ich das Wort Kunstwerk ueberhaupt nicht, weil es so albern und aufgeblaeht klingt. Sowohl Texte als auch Bilder bleiben, was sie von ihrem Ursprung her sind. Nichts daran aendert sich. In ihrer Stille besitzen sie eine ungeheure, nie absolut verfuegbare Praesenz.
Manchmal ist mehr das Gerede ueber ein Kunstwerk als das Kunstwerk im Umlauf.
Leider! Wenn Sie dann das Buch lesen, sind Sie ueberrascht, weil es niemals dem Kommentar entspricht, und wenn Sie das Kunstwerk sehen, so sind sie ueberrascht, weil keine noch so gute Beschreibung etwas von ihm in seiner tatsaechlichen Erscheinung beruehrt hat. Das alles sind Parallelaktionen, fern vom Eigentlichen. Das Schoene daran ist, dass jeder fuer sich den literarischen Text oder das gemalte Bild erneut erfinden kann. Drum gefaellt es mir, dass alle UEbersetzungen schlecht sind, so dass man gezwungen ist, nach einiger Zeit von vorne anzufangen, und dass alle Beschreibungen so unzutreffend sind, dass man gezwungen ist, doch die Bilder im Original zu sehen, um zu wissen, wovon eigentlich gesprochen wurde. Nur schade, dass jeder UEbersetzer meint, die endgueltige UEbersetzung geschaffen zu haben. Es wird aber nie die endgueltige UEbersetzung, nie die endgueltige Sicht auf ein Gemaelde oder eine Plastik geben. Es kann immer nur um eine sich selbst relativierende Annaeherung gehen, die die Offenheit eines Kunstwerks und dessen Aura nicht leugnet. Das endgueltig letzte Bild waere das Ende der Welt. Der stumme Tiefsinn von Bildern und Texten rettet uns davor, dass alles ein Ende findet.
Dazu passt auch der heilsame Charakter des Vergessens.
Natuerlich, so heisst es auch bei Henri Bergson: Die Funktion ist nicht das Gedaechtnis, sondern das Vergessen. Das Vergessen ist eine Funktion, alles ist Gedaechtnis. Nur der Mensch hat es geschaffen, und er hat dieses Loch im Gedaechtnis.
BILDUNTERSCHRIFTEN
Foto: Heinz-Norbert Jocks
|
ttc
|

|
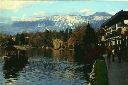
|
|
ttc
|
ttc
|
 Image title would go here.
Image title would go here.
|

|
|
|
Tttc
|

|
 Image title would go here.
Image title would go here.
|
|
ttc
|
ttc
|
 Image title would go here.
Image title would go here.
|
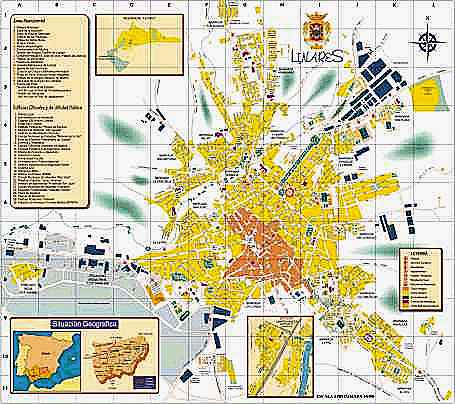
|
|
ttc
|
ttc
|
|